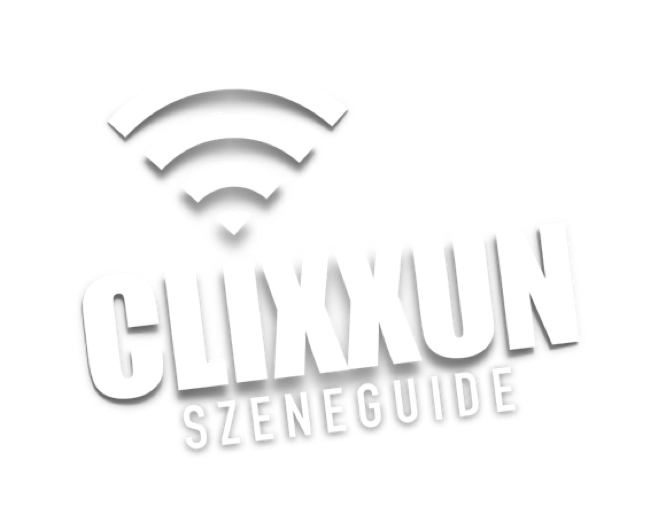Die neue Lehnsherrschaft
Im klassischen Feudalismus war die Welt einfach: Der Adel besaß Land, die Bauern arbeiteten darauf – und gaben einen Teil ihres Ertrags ab, in Form von Abgaben, Loyalität und Wehrdienst. Freiheit war relativ; Abhängigkeit der Normalzustand.
Heute ist das Land durch digitale Plattformen ersetzt. Amazon, Google, Apple, Microsoft – sie besitzen nicht nur die Daten, sie kontrollieren auch die Infrastruktur, durch die unsere Kommunikation, unser Konsum und unsere Arbeit fließen. Sie nehmen „digitale Mieten“ – Sichtbarkeit, Zugriff, Nutzerbindung. Ohne diese Konzerne kann kaum jemand wirtschaften. Die Plattform wird zum neuen Grundbesitz.
Varoufakis geht noch weiter: Der Kapitalismus, wie wir ihn kannten – mit Märkten, Konkurrenz und Investitionslogik – wäre längst tot. An seine Stelle sei ein System getreten, in dem nicht Kapital das Sagen hat, sondern digitale Kontrolle, Monopole und algorithmische Macht. Produktivität tritt in den Hintergrund – stattdessen zählt Reichweite, Zugriff und das Sammeln von Informationen.
Demokratie – als Ritual
Das Paradoxe wäre demnach daran: Während Macht sich entkoppelt von demokratischen Institutionen, halten wir weiter an demokratischen Formen fest. Wahlen, Parteien, Parlamente – alles da. Doch die zentralen Entscheidungen, etwa zur Geldpolitik, zu Konzernregulierung oder zu Handelsabkommen, werden längst nicht mehr wirklich dort getroffen. Stattdessen verhandeln Technokraten – wie Varoufakis sie aus der Eurokrise kennt – über Milliardenhilfen in Hinterzimmern, während nationale Parlamente später nur noch öffentlich abnicken dürfen, damit die Menschen ruhig bleiben.
Diese Entkoppelung führt seiner Meinung zu einem Zustand, den auch Politologen als „Postdemokratie“ bezeichnen: Der Anschein demokratischer Teilhabe bleibt bestehen, aber die reale Macht ist längst woanders. Interessanter Gedanke, wenn man bedenkt, wie wichtig mittlerweile TikTok etcetera geworden ist, was den Wahlkampf angeht.
Warum wählen wir dann so, wie wir wählen?
Ein Widerspruch bleibt m.E., der von Varoufakis nicht öffentlich thematisiert wurde: Wenn so viele Menschen unter diesem System leiden – warum wählen sie dann zumeist Parteien, die es stützen? Die CDU/CSU, die SPD, die FDP, die AfD, größtenteils auch die Grünen – sie alle tragen wirtschaftliche Strukturen mit, die die soziale Spaltung vertiefen, Arbeitsmärkte flexibilisieren, Plattformen kaum antasten. Die Linke oder progressive Bewegungen, die systemische Kritik äußern, bleiben dabei oft unter ihren Möglichkeiten. Warum?
Vier Erklärungen drängen sich auf:
1. Die Angst vor Instabilität.
Viele Menschen haben erlebt, wie politische und wirtschaftliche Experimente in Unsicherheit mündeten. Die Eurokrise, die Migrationsdebatte, die Pandemie – all das hat das Bedürfnis nach Ordnung und Berechenbarkeit verstärkt. Bürgerliche Parteien bieten genau das: einen Verzicht auf radikale Veränderungen, einen Pragmatismus, der Sicherheit verspricht.
2. Die mediale Filterblase.
Große Teile der Leitmedien bedienen bürgerliche Perspektiven. Linke Alternativen werden oft als chaotisch, populistisch oder wirtschaftsfern dargestellt – selbst dann, wenn sie sachlich fundiert sind. Varoufakis selbst wurde in der europäischen Presse zur Karikatur stilisiert: als radikaler Professor mit Motorrad, statt als Mahner vor einem Systemversagen.
3. Die fragmentierte Gesellschaft.
Das System spaltet – in prekär Beschäftigte, in Kleinunternehmer, in Migranten, in Mittelständler mit Abstiegsangst, jung und alt, Mann und Frau. All diese Gruppen finden oft keinen gemeinsamen politischen Nenner - oder sollen keinen finden. Statt sich zu verbünden, kämpfen sie gegeneinander um knappe Ressourcen – eine Dynamik, die auch dem alten Feudalismus nicht fremd war.
4. Die Ohnmachtserfahrung.
Viele Bürger glauben nicht mehr, dass Politik ihre Lage ändern kann. Die Agenda 2010, die Bankenrettungen, die Austeritätspolitik – all das hat Spuren hinterlassen. Wenn das Gefühl überwiegt, dass „die da oben“ ohnehin machen, was sie wollen, dann wird die Wahl zur symbolischen Geste. Man wählt, was man kennt – nicht, was man braucht. Also selbst Parteien „mit Dreck am Stecken“ werden gewählt, weil man sie schon „kennt“.
Auswege? Ja – aber unbequem
Yanis Varoufakis hat nie aufgehört, für Alternativen zu kämpfen. Das finde ich persönlich sehr gut, weil ich in den letzten Jahren auch immer mehr kritisch betrachte, was aus der Demokratie geworden ist. Mit seiner paneuropäischen Bewegung DiEM25 fordert er eine Demokratisierung Europas, eine Rückeroberung politischer Macht durch die Bürger - gewissermaßen. Doch diese Vision braucht Geduld, Bildung, und – Mut. Wie ich oft in meinen Texten hier formuliert habe: Mut- statt Wutbürger!
Denn eines ist klar: Wer aus diesem Technofeudalismus ausbrechen will, wird sich nicht auf das verlassen können, was heute als „politische Mitte“ gilt. Diese Mitte ist eher die Spitze der wirtschaftlichen „Pyramide“. Es braucht endlich eine neue politische Vorstellung davon, was Freiheit, Teilhabe und Eigentum im 21. Jahrhundert bedeuten sollen. Und die Bereitschaft, die digitale Leibeigenschaft zu erkennen – bevor sie zur neuen Normalität wird.
In einer Welt, in der der König (Souverän) kein Mensch mehr ist, sondern ein Algorithmus, wird es Zeit, dass die Bürger wieder zu Subjekten werden – nicht nur zu Konsumenten.